Arbeitsvermittlung: Nicht jedes Förderprogramm nützt bei allen gleich viel.
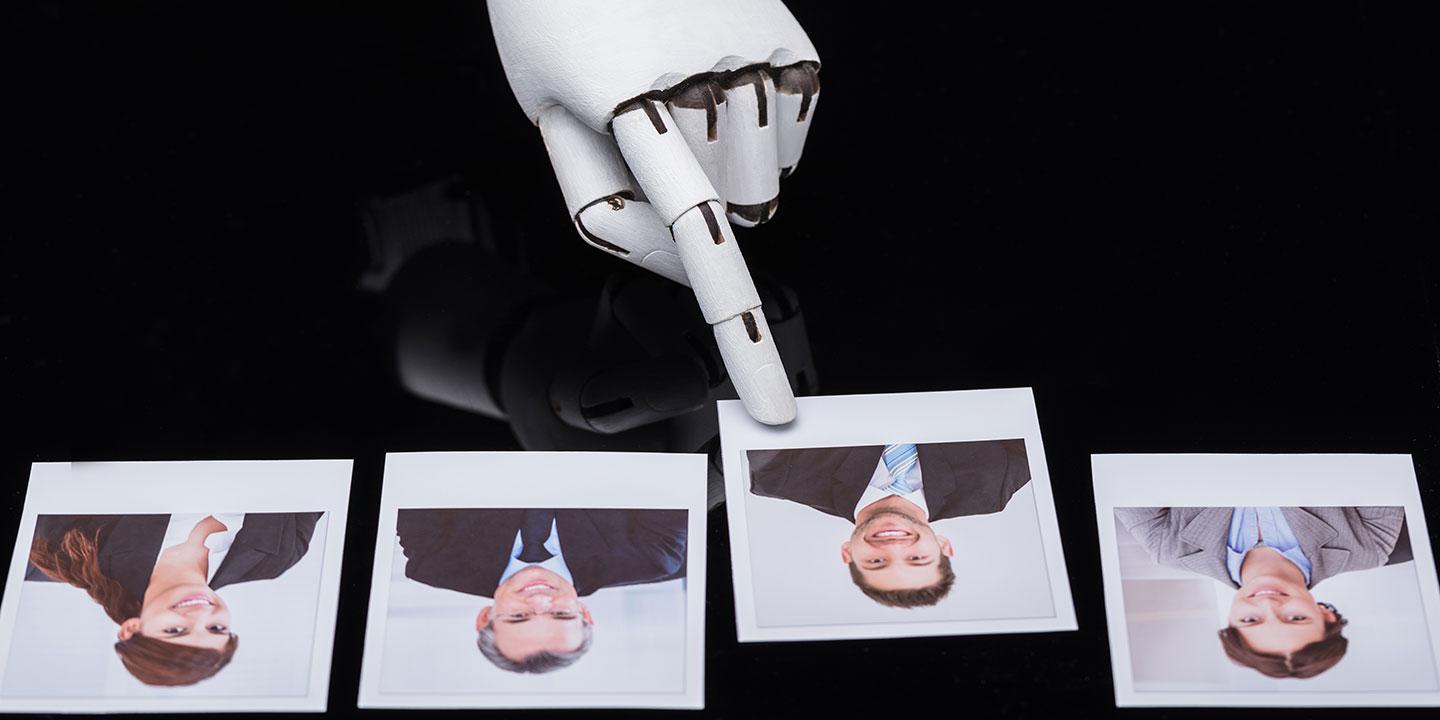
Ein Forschungsteam entwickelte ein Empfehlungssystem, das hilft, Arbeitslose gezielter passenden Kursen oder Programmen zuzuweisen – damit Fördermassnahmen dort wirken, wo sie am meisten bringen.
In Zeiten der digitalen Transformation stellt sich die Frage: Können datengetriebene Entscheidungsmodelle die Arbeitsvermittlung verbessern? Dieser Frage widmeten sich Michael Lechner (Universität St.Gallen) und sein Team im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes NFP 77.
Ziel war es, die Vermittlung von Unterstützungsangeboten an Arbeitslose mithilfe von Daten und Algorithmen effizienter zu gestalten. Hierfür nutzte das Team modernste Methoden des kausalen maschinellen Lernens – also maschinelle Lernverfahren, die Ursache-Wirkung-Zusammenhänge erkennen – und entwickelte ein algorithmisches Empfehlungssystem. Damit könnten Arbeitslosen passgenauere Förderprogramme empfohlen werden. Zu solchen Programmen zählen beispielsweise Weiterbildungskurse, Bewerbungstrainings oder subventionierte Beschäftigungen, die die Jobchancen von Arbeitslosen erhöhen sollen.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Mit dem Machine-Learning-Verfahren konnte das Forschungsteam sehr fein aufschlüsseln, wie stark die verschiedenen Programme jedem/r einzelnen Arbeitslosen nützen und somit die Wirksamkeit eines Teils der schweizerischen aktiven Arbeitsmarktpolitik messen.
Die Analyse brachte deutliche Unterschiede zutage: Manche Förderprogramme steigern für bestimmte Gruppen von Arbeitslosen erheblich die Chance, wieder eine Anstellung zu finden oder ein höheres Einkommen zu erzielen, während sie bei anderen Gruppen kaum Wirkung zeigen. So profitierte beispielsweise eine Personengruppe stark von einem speziellen Weiterbildungskurs, während ein anderes Programm eher einer anderen Gruppe half. Solche Befunde bestätigen, wie wichtig es ist, differenziert hinzuschauen – was für den Durchschnitt der Teilnehmenden funktioniert, ist nicht automatisch für jeden Einzelnen gleich wirksam.
Auf Basis dieser detaillierten Ergebnisse entwickelten die Forschenden ein algorithmisches Empfehlungssystem: Es schlägt für neu gemeldete Arbeitslose mit bestimmten Merkmalen jeweils dasjenige Programm vor, von dem diese voraussichtlich am meisten profitieren werden. Dabei berücksichtigt das System auch praktische Beschränkungen wie begrenzte Kursplätze oder Budgetvorgaben.
Wichtig war den Forschenden zudem, die Empfehlungen nachvollziehbar zu machen. Ein sogenannter Policy Tree stellt die optimale Zuweisungsregel als übersichtlichen Entscheidungsbaum dar, sodass Praktiker:innen leicht erkennen können, auf welchen Kriterien die Empfehlung basiert. So bleibt die Interpretierbarkeit gewahrt und die Zuweisungsempfehlungen können von Entscheidungstragenden vertrauensvoll genutzt werden.
Bedeutung für Politik und Praxis
Für die Arbeitsmarktpolitik und die Praxis der Arbeitsvermittlung bieten diese Ergebnisse vielversprechende Ansatzpunkte. Durch den Einsatz datenbasierter Entscheidungsalgorithmen könnten Arbeitsvermittler Massnahmen künftig gezielter und damit effizienter einsetzen. Sie bekämen ein Werkzeug an die Hand, das ihnen bei der Auswahl passender Programme für einzelne Stellensuchende hilft. Insgesamt liessen sich so die begrenzten Ressourcen – wie Kursplätze oder Fördergelder – optimaler verteilen, um einen möglichst grossen Nutzen zu erzielen.
Gleichzeitig machen die Erkenntnisse des NFP 77-Forschungsprojektes deutlich, dass für einen erfolgreichen Einsatz einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Es braucht neben umfassenden Daten und einer passenden IT-Infrastruktur vor allem kompetente Fachleute, die verstehen, wie die Algorithmen funktionieren und wie man ihre Empfehlungen richtig deutet.
Drei Hauptbotschaften
- Verwende kausales maschinelles Lernen, um besser zu verstehen, welches öffentliche Programm für wen wirkt.
- Setze datenbasierte Entscheidungsalgorithmen ein, um die Zuteilung von Personen zu spezifischen Programmen zu verbessern.
- Idealerweise sollte es eine kontinuierlich aktualisierte, integrierte Daten-Entscheidungs-Pipeline geben: ein fortlaufender Datenfluss sowie eine halbautomatische Aktualisierung der Evaluationsergebnisse und der daraus abgeleiteten politischen Empfehlungen.
Wie die Forschenden methodisch genau vorgegangen sind und weitere Hintergründe zum Forschungsprojekt finden Sie auf der NFP 77-Projektwebseite:
Weitere Forschungsprojekte zum Thema «Digitale Transformation» im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes NFP 77 finden Sie hier:
